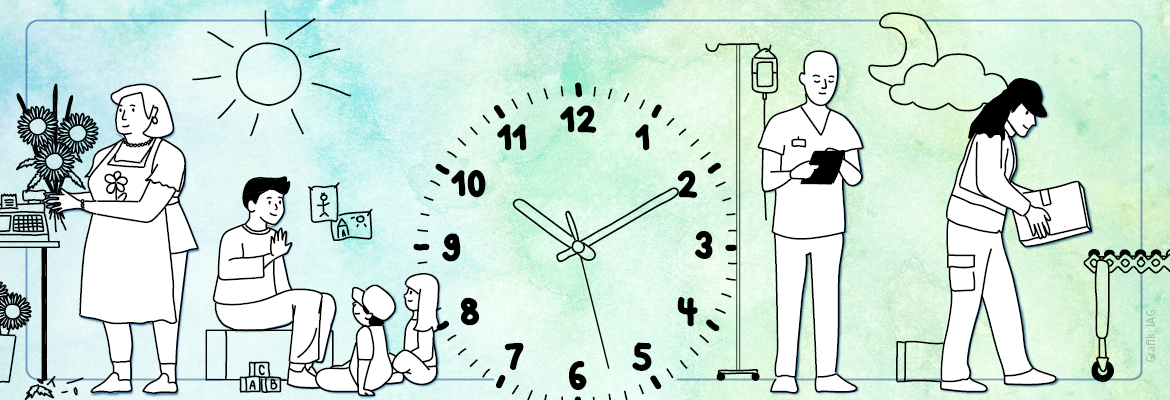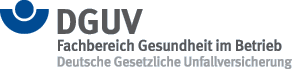
Dauer der Arbeitszeit

Praxisbeispiel
In einem großen Chemiekonzern muss quartalsweise eine Aufstellung der Finanzen erstellt werden, die an die Konzernleitung und an die Presse übermittelt wird. Die Erstellung erfolgt durch hochqualifizierte und -spezialisierte Fachkräfte. Zwei Wochen vor Abgabe des Berichtes besteht Urlaubssperre. Überlange Arbeitszeiten bis in die Nachtstunden sind Standard. Die Beschäftigten wissen, dass die Erstellung des Quartalsberichtes Teil ihrer Tätigkeit ist. Ihre Spezialisierung und Qualifizierung sowie die besondere Bedeutung der Tätigkeit für den Konzern macht sie stolz. Dennoch berichten die Beschäftigten während dieser Zeit von massiven Belastungen für Körper und Geist. Nach ihrer Einschätzung würde die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte sie jedoch nicht entlasten, da dies mehr Absprachen erfordern und dadurch zu mehr Unruhe und einer erhöhten Fehlergefahr führen würde.

Mögliche Gefährdungen
Durch überlange Arbeitszeiten fehlt Beschäftigten die Möglichkeit, sich ausreichend von der Arbeit zu erholen. Durch häufige bzw. über einen längeren Zeitraum bestehende Überstunden steigt die Wahrscheinlichkeit für Herzkreislauf-Erkrankungen und Diabetes-Typ 2. Auch Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Müdigkeit und Erschöpfung sind als Folge möglich. Besonders kritisch sind überlange Arbeitszeiten bei Tätigkeiten mit langandauernd hohen Konzentrationsanforderungen (z. B. Überwachungsarbeiten).

Schutzziele
Die Arbeitszeit ist gut gestaltet, wenn sie klar begrenzt ist. Für die Beschäftigten müssen ausreichende und störungsfreie Pausen-, Ruhe- und Erholungszeiten sichergestellt sein.

Beispielhafte Maßnahmen
In der Reihenfolge S-T-O-P soll geprüft werden, ob es passende Maßnahmen zum Schutz vor einer Gefährdung gibt.
Substitution
- In diesem Beispiel wurden keine substituierenden Maßnahmen getroffen.
Technische Maßnahmen
- In diesem Beispiel wurden keine technischen Maßnahmen getroffen.
Organisatorische Maßnahmen
- Prüfung, ob bestimmte, abgegrenzte Vorbereitungstätigkeiten möglich sind, um in der Hochphase schneller bzw. gezielter agieren zu können.
- Vereinbarung, dass in der Woche nach Abgabe des Quartalsberichtes keine neuen Aufträge an die Beschäftigten der Abteilung herangetragen werden. Dadurch haben sie die Möglichkeit, die Arbeitszeit in diesem Zeitraum flexibler zu gestalten und sich dadurch besser zu erholen. In dieser Zeit können zudem liegengebliebene Aufgaben aufgearbeitet werden, z.B. Routinetätigkeiten mit geringeren Konzentrationsanforderungen und Tätigkeiten mit geringerem Leistungsdruck.
- Möglichkeit eines Tätigkeitswechsels innerhalb des Konzerns, wenn die Belastung für Beschäftigte mit der Zeit zu hoch wird.
- In den regelmäßigen Mitarbeitergesprächen werden mögliche Überlastungsreaktionen thematisiert, um für das Thema Erkennen von und Umgang mit eigenen Überlastungsreaktionen zu sensibilisieren.
-
Ein Ruheraum für Pausen mit einer Schlafmöglichkeit ist eingerichtet worden. Für die
Hochphasen ist der Raum für die Mitarbeiter dieser Abteilung reserviert, damit diese ihn zum Beispiel für Powernaps nutzen können. Eine kurze Mitteilung an einen Kollegen ist ausreichend für die Inanspruchnahme der Sonderpause. Mit einem Besetzt- / Frei-Schild wird die Nutzung des Raumes angezeigt.
Personenbezogene Maßnahmen
- Die Beschäftigten können bei Bedarf eine persönliche Beratung durch ein Employee Assistance Programm in Anspruch nehmen.
- Es werden passende Maßnahmen der Gesundheitsförderung angeboten, um mit Hilfe von Bewegungs- und Entspannungsprogrammen die Resilienz der Beschäftigten zu erhöhen.
Weitere Informationen

- BAuA-Fokus: Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu Arbeitszeit
- Kulturdialoge: Prävention – Dialogkarten zum Thema Arbeitszeitgestaltung
- CHECK-UP Homeoffice - Langversion
- IAG Report 2/2019: "Arbeitszeit sicher und gesund gestalten"
- Kulturdialoge: Prävention - Dialogkarten zum Thema Arbeitszeitgestaltung